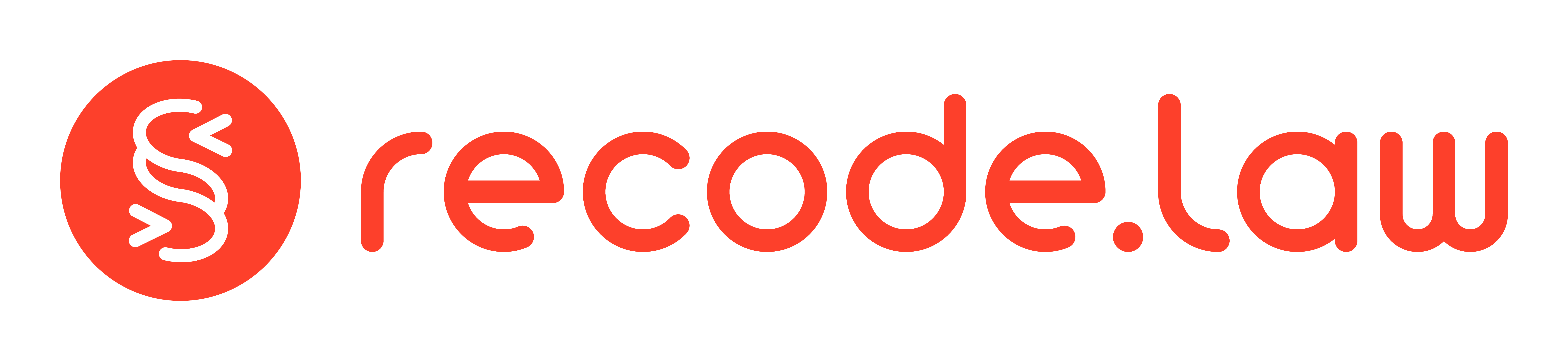Liebe Leser:innen,
herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Newsletters, in dem wir Euch einen umfassenden Überblick über die jüngsten Entwicklungen an der Schnittstelle von Recht und Technik geben.
Als Erstes stellen wir Euch drei Thesen zu Prüfungsformaten in einer modernen juristischen Ausbildung vor, die kürzlich von einer Gruppe Rechtswissenschaftler:innen veröffentlicht wurden.
Während Ausbildungsreformen noch in den Sternen stehen, verändert sich die Hochschullandschaft bereits. Wir stellen zwei Leuchtturmprojekte vor.
Schließlich berichten wir, welche zivilrechtlichen Folgen es haben kann, wenn man KI-generierte Stimmen zu geschäftlichen Zwecken nutzt.
Und Lese- sowie Veranstaltungsempfehlungen haben wir am Ende natürlich auch noch für Euch.
Wir hoffen, dass diese Ausgabe Euch neue Einblicke bietet und zum Nachdenken anregt. Viel Spaß beim Lesen!
Redaktion: Anton, Friedrich, Marco, Patrick, Veronika, Elena und Victoria.
Juristisches Prüfen 2030
Zukunft der juristischen Prüfung: Drei Thesen für eine moderne Ausbildung
Renommierte Jurist:innen aus Forschung und Lehre formulierten auf dem Verfassungsblog drei Thesen zur Zukunft juristischer Prüfungen, die Grundlage für eine weitergehende Debatte geben sollen.
Zunächst wird angeführt, dass gegenwärtige Prüfungsformate der juristischen Ausbildung einem modernen Arbeitsumfeld nicht gerecht werden. Der Umgang mit digitalen Hilfsmitteln und künstlicher Intelligenz, die in der Praxis kaum noch wegzudenken sind, bleibt in der gesamten Ausbildung weitgehend unbeachtet.
Mit Blick auf eine Zukunft, in der Künstliche Intelligenz zunehmend in der Lage ist, juristische Standardprobleme eigenständig zu lösen, stellt sich die Frage nach dem Prüfungswert juristischer Hausarbeiten. Wenn sich der individuelle Eigenbeitrag kaum noch verlässlich messen lässt, droht dieses Prüfungsformat an Aussagekraft zu verlieren. Die Autor:innen schlagen vor, Hausarbeiten als sogenannte „KI-Hausarbeiten“ weiterzuentwickeln: Der Einsatz von KI soll ausdrücklich erlaubt, aber zugleich transparent gemacht und kritisch reflektiert werden. So könne das Format erhalten bleiben und weiterhin relevante Kompetenzen prüfen, etwa den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Werkzeugen, präzise Quellenprüfung und juristische Argumentation.
Bei Klausuren sehen die Jurist:innen ebenfalls Reformbedarf. Sie schlagen differenzierte Formate vor, die den Umgang mit digitalen Hilfsmitteln gezielt einbeziehen: von klassischen Klausuren ohne Zugriff auf externe Ressourcen über Hybridklausuren mit begrenztem Hilfsmitteleinsatz bis hin zu offenen „KI-Klausuren“, bei denen der reflektierte Einsatz digitaler Tools mitgeprüft wird. So soll nicht nur Fachwissen, sondern auch die Fähigkeit gefördert werden, moderne Technologien verantwortungsvoll in juristische Arbeitsprozesse einzubeziehen.
Legal Innovation in der Wissenschaft
Stanford und Bucerius Universität fördern praxisnahe Innovation im Rechtswesen
Die Verwendung von KI-Anwendungen im Rechtswesen ist kein neues Thema. Die meisten der automatisierten Lösungen zielen bis jetzt aber vor allem auf die Steigerung von Kanzleieffizienz – etwa durch automatisierte Recherche oder beschleunigte Dokumentenverarbeitung.
Das neu gegründete liftlab (Legal Innovation through Frontier Technology Lab) der Stanford Law School verfolgt jedoch eine breitere Mission: KI soll nicht nur Effizienz bringen, sondern auch den Zugang zum Recht gerechter, transparenter und breiter zugänglich machen.
Diese Vision soll vor allem mit konkreten technischen Schwerpunkten erreicht werden:
- Legal Personas: Mit Hilfe von Sprachmodellen soll das implizite Wissen erfahrener Jurist:innen extrahiert und kodiert werden. So können Modelle entstehen, die typische juristische Abwägungen und Entscheidungsprozesse abbilden und als Forschungsinstrumente wie auch als praxisnahes Trainingswerkzeuge dienen.
- Contractual Drafting Risk Assessment: Verträge werden oft durch sprachliche Vagheit oder Unbestimmtheit streitanfällig. Das LiftLab setzt KI ein, um genau diese Risikostellen zu identifizieren und daraus Empfehlungen für die Vertragsgestaltung abzuleiten – ein Ansatz, der Vertragsqualität messbar verbessern kann.
- Multi-Agent Simulation for Evaluation: Durch Simulationen mit mehreren KI-Agenten lassen sich interne Abläufe in Kanzleien analysieren. Ziel ist es, Schwachstellen in Arbeitsprozessen sichtbar zu machen und neue Organisationsmodelle realistisch zu testen, bevor sie in der Praxis umgesetzt werden.
- AI-driven Simulation Training: Nachwuchsjurist:innen sollen durch KI-gestützte Trainingsplattformen praxisnah Verhandlungen und andere zentrale Skills üben können. Szenarien werden so gestaltet, dass sie komplexe, realistische Fälle nachahmen und Lernfortschritte objektiv messbar machen.
- Applied Mechanistic Interpretability: Ein besonders innovativer Ansatz ist die Anwendung von „Model Pruning“ in rechtlichen Kontexten. Dabei werden Neuronen in Sprachmodellen, die nachweislich bias-basiertes Verhalten erzeugen, gezielt deaktiviert oder entfernt – mit dem Ziel, diskriminierende Verzerrungen systematisch zu reduzieren.
Währenddessen gibt es auch in Deutschland spannende Neuigkeiten. Besonders hervorzuheben ist die Bucerius Law School in Hamburg mit ihrem neu gegründeten Bucerius Legal Innovation Hub (“BLIH”), der interdisziplinäre Forschung, Kooperation mit der Praxis und neue Ausbildungsformaten verbindet. Der Hub ist aus den bereits bestehenden Forschungszentren des Bucerius Center on the Legal Profession (“CLP”) und Bucerius Center for Legal Technology and Data Science (“CLTDS”) hervorgegangen. Die inhaltliche Arbeit soll sich um die folgenden vier Themen drehen: Rechtswissenschaft & Technologie, Zukunft der juristischen Profession, Strukturwandel im digitalisierten Rechtsmarkt sowie Innovation & Führung in der Rechtsbranche.
Voice Cloning
Fiktives Honorar für KI Stimme
Wie bereits von Jurios berichtet, ist vor dem LG Berlin II (Urteil vom 20.08.2025 – 2 O 202/24; GRUR-RS 2025, 22042) ein Urteil zu einer KI generierten Stimme ergangen. Durch die fortgeschrittenen Anwendungsfälle von Künstlicher Intelligenz treten Parodien immer häufiger auf. Wobei die Nutzung fremder Bildnisse noch spezialgesetzlich durch das KunstUrheberGesetz (KunstUrhG) geregelt ist, findet sich eine solche Regelung nicht für die Stimme.
Das Gericht führt aus, dass die Stimme im selben Maße ein Ausdruck des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist, wie das Bildnis einer Person (GRUR RS 2025, 22042, Rn. 12 f.). Die Anspruchsgrundlage des Inhabers der Stimme rührt somit aus § 823 I BGB i.V.m. Art. 2 I, 1 I GG her.
Das „Voice Cloning“ ist die „KI-gestützte Erzeugung von Toninhalten […] die der Stimme einer Person merklich ähneln und Dritten fälschlicherweise als echt oder wahrhaftig erschein[t]“ (Ellenberg, Persönlichkeits- und Urheberrechte beim Voice Cloning, RDi 2024, 599). Bei dem Eingriff in die Persönlichkeitsrechte kommt es alleinig darauf an, ob aus Sicht eines objektiven Dritten die Stimme der Person zugeordnet werden kann und die Person dadurch in den Kontext mit einem Inhalt gesetzt wird oder sogar auch nur eine gezielt herbeigeführte Ähnlichkeit zu der imitierten Stimme.
Im Wesentlichen wird in dem Urteil festgestellt:
1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt auch wirtschaftliche Interessen an der eigenen Stimme.
2. Die Nutzung ohne Einwilligung ist unabhängig davon unzulässig, ob die Stimme von einer KI oder einem Menschen erstellt wird.
3. Die Regeln zur unberechtigten Nutzung der Stimme.
Der Eingriff könnte gerechtfertigt sein, analog §§ 22, 23 KUrhG, wenn die Verwendung im Bereich der Zeitgeschichte, der Satire oder der Kunst erfolgt. Der Fall vor dem Berliner Gericht war jedoch unabhängig von politischer Satire und hatte teilweise sogar einen geschäftlichen Bezug, sodass die Rechtfertigungsgründen nicht eingreifen. Eine zusätzliche Besonderheit bei dem Voice Cloning ist, dass nicht nur die Veröffentlichung, sondern auch die Erstellung der Stimme eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte darstellt (vgl. Ellenberg, Persönlichkeits- und Urheberrechte beim Voice Cloning, RDi 2024, 599, 602ff.).
Das Urteil des Landgerichts bringt somit keine neue juristische Konstruktion mit sich, sondern bestätigt nur, dass der bisherige Schutz des Allgemeinen Persönlichkeitsrechtes auch auf die Nutzung durch die KI anwendbar ist.
Lese-Tipp
AI-Startup wird zur eigenen Kanzlei – Ein Richtungswechsel der juristischen Welt?
Das KI-Start-up Eudia hat in Arizona eine eigene „KI-gestützte“ Anwaltskanzlei eröffnet. Möglich wurde das durch neue Regeln im Bundesstaat, die es auch Nicht-Jurist:innen erlauben, Anteile an Kanzleien zu halten.
Die neue Kanzlei, Eudia Counsel, kombiniert eigene KI-Tools mit klassischer Rechtsarbeit und bietet Unternehmen Dienstleistungen wie Vertragsanalysen oder Due Diligence bei M&A-Prozessen an.
Das zeigt einen klaren Trend: Statt nur Software für Kanzleien zu entwickeln, werden manche Firmen nun selbst zu Kanzleien und verändern damit Rollenbilder und Geschäftsmodelle in der Rechtsbranche. Für Studierende mit Interesse an Recht, Tech oder Unternehmertum ein spannendes Thema.
Hier findet ihr mehr zum Thema.
Lese-Tipp
Künstliche Intelligenz und richterliche Entscheidungsfindung – ein erster Meilenstein
Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt der Georg-August-Universität Göttingen und des Niedersächsischen Justizministeriums untersucht, wie künstliche Intelligenz Richter:innen künftig unterstützen könnte. Im Mittelpunkt stehen Fragen der Transparenz, Fairness und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Grenzen automatisierter Systeme in komplexen Verfahren. Die ersten Ergebnisse zeigen, wie groß die Chancen, aber auch die Herausforderungen für den Einsatz von KI in der Rechtsprechung sind.
Hier geht’s zur Originalmeldung der Uni Göttingen: KI und richterliche Entscheidungsfindung
Veranstaltungstipp
Workshop mit Wolters Kluwer – Juristische Recherche 2.0
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verändern die juristische Arbeit – von Recherche über Analyse bis hin zur Fallvorbereitung und Entscheidungsfindung.
Beim Event „Juristische Recherche im digitalen Zeitalter“ laden wir euch zusammen mit Wolters Kluwer Deutschland und dem Legal Tech Lab Cologne am 7.10. um 17:30 Uhr in Köln ein, um genau diese Veränderung zu beleuchten: Welche modernen Tools stehen uns zur Verfügung? Wie kann KI die Praxis effizienter und smarter machen?
Florian Juterschnig von recode.law, Dante Browder vom LTLC und Philipp Stock von Wolters Kluwer Deutschland werden diese Fragen beantworten und ihre Perspektive teilen.
Auf unserer Webseite könnt ihr euch direkt einen Platz sichern und mehr Informationen finden.
Veranstaltungstipp
Workshop mit YPOG – Wie verändert die KI die juristische Praxis
KI verändert die juristische Arbeit – von Recherche über Dokumentenprüfung bis hin zur strategischen Beratung. Gemeinsam mit YPOG Berlin zeigen wir Euch im Workshop „Zwischen Paragraphen und Programmcode – Wie verändert KI die juristische Praxis“ am 5. November 2025 ab 16:00 Uhr, wie KI bereits heute Kanzleien unterstützt – und wo ihre Grenzen liegen.
Freut Euch auf praxisnahe Beispiele, einen interaktiven Austausch und die Gelegenheit zum Networking bei Fingerfood und Drinks.
Hier geht es zur Anmeldung! Alle weiteren Details zum Ablauf veröffentlichen wir demnächst auf unserer Website – vorbeischauen lohnt sich!
Last Updated on 2. Oktober 2025