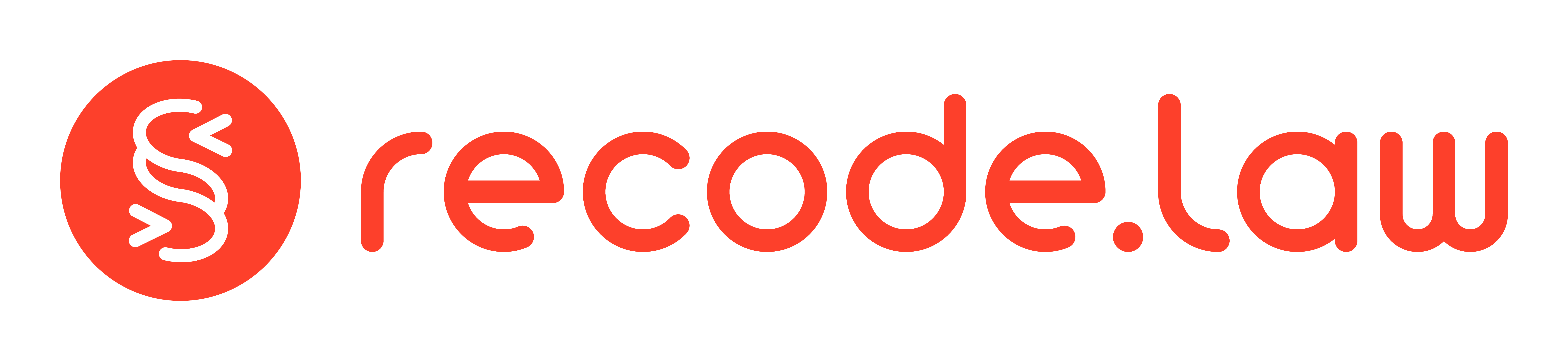Liebe Leser:innen,
herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Newsletters, in dem wir Euch einen umfassenden Überblick über die jüngsten Entwicklungen an der Schnittstelle von Recht und Technik geben.
Diesmal geht es um die gegensätzlichen Perspektiven auf das aktuelle Potenzial von KI im Rechtsalltag. Außerdem blicken wir auf die Entscheidung des LG Hamburg gegen Elon Musks xAI und die Frage, wie KI-Halluzinationen rechtlich einzuordnen sind.
In unserer Rubrik Legal Education 2.0 zeigen wir, wie sich die juristische Ausbildung im digitalen Zeitalter neu erfinden muss. Dazu gibt’s einen spannenden Podcast-Tipp zur KI in der Klausurbewertung sowie Veranstaltungshinweise vom German Legal Tech Summit bis zum Promptathon mit Libra in Berlin.
Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen und freuen uns über Feedback an radar@recode.law!
Euer recode.law-Team
Redaktion: Elena, Felix, Konstantin, Marco, Patrick, Veronika und Victoria.
Die Realität von KI in der Rechtsbranche
Zwischen radikalem Wandel und Ernüchterung
Seit Jahren verspricht der Einsatz künstlicher Intelligenz tiefgreifende Veränderungen in der juristischen Welt. Einige sehen die juristische Praxis kurz vor einer technologischen Revolution, andere erleben vor allem Ernüchterung. Die Debatte oszilliert damit zwischen dem Glauben an einen baldigen radikalen Wandel und der Realität heutiger Systeme, die oft hinter den Versprechungen zurückbleiben. Zwei aktuelle Beiträge illustrieren diese Spannbreite besonders deutlich.
Im Beitrag „The Five-Year Reckoning – Why Legal Education Must Evolve or Perish“ von Tobias H. Tröger wird ein visionäres Szenario entworfen: Artificial General Intelligence (AGI) sei in rund fünf Jahren erreichbar und werde die Rechtsberatung grundlegend transformieren. Die Rolle von Jurist:innen als „Gatekeeper“ werde enden; Verträge würden dank Beratung durch AGI präziser, Transaktionen besser strukturiert und Gerichtsentscheidungen einfacher vorhersehbar. Nach dieser Sichtweise würde der dadurch herbeigeführte Rückgang an Rechtsstreitigkeiten menschliche Rechtsberatung obsolet machen. Wenn KI-Systeme dann auch noch weniger Fehler als Menschen machen, brauche es auch keine menschliche Kontrolle der KI-Arbeit mehr, dafür werde allein schon die Marktlogik sorgen. Als Beleg dieser These zieht der Autor Parallelen zu Taschenrechnern und Computern, deren Ergebnisse ebenfalls ungeprüft übernommen werden. Legal-Education müsse daher neu gedacht werden: nicht mehr für künftige Prozessanwält:innen, sondern für reflektierte Architekt:innen rechtlicher Rahmenbedingungen und KI-gestützter Systeme, die sozial verträglich sind. Der juristische Beruf wandelt sich aus dieser Perspektive nicht, er löst sich auf zugunsten juristisch denkender Technologiegestalter.
Demgegenüber steht der Beitrag „AI-Slop im Kanzleialltag: Bremst “KI-Müll” die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten aus?“ von Tobias Voßberg, der eine deutlich skeptischere Momentaufnahme vornimmt. Trotz großer PR-Welle und ambitionierter Tool-Rollouts verändern KI-Systeme den Kanzleialltag bislang kaum. Es gebe zwar spürbare Erleichterungen bei Routineaufgaben wie E-Mails, Textzusammenfassungen oder Datenextraktion. Doch klassische juristische Arbeit, bestehend aus Recherche, Argumentation und Schriftsätzen, werde nicht schneller. Im Gegenteil: Oberflächliche KI-Entwürfe („AI-Slop“) erzeugen häufig Mehrarbeit. Viele vollmundig angepriesene Systeme werden nach einer starken Pilotphase kaum genutzt. Wahrgenommene Effizienz und reale Produktivität klaffen auseinander, und der Hype sei in Teilen eine selbstverstärkende Echokammer, die immer weiter gefüttert werde mit ironischerweise oft von KI erstellten Beiträgen. Der Autor plädiert nicht für einen Verzicht auf KI, die er für ein extrem nützliches Werkzeug hält, sondern für einen Ausbruch aus der Echokammer und eine Abkehr von überteuerten Tools, die am Ende nicht mehr leisten als ChatGPT.
Ob der juristische Beruf tatsächlich vor einer baldigen Disruption steht oder uns doch eine längere Phase pragmatischer Integration bevorsteht, wird weniger von der überzeugenderen Rhetorik in der aktuellen Debatte als von realer Leistungsfähigkeit künftiger Systeme abhängen. Bis dahin heißt es, gespannt die Weiterentwicklung der juristischen Arbeit zwischen Hype und Skepsis zu beobachten.
KI im Fadenkreuz des Rechts
Landgericht Hamburg: Einstweilige Verfügung gegen Musks xAI und Chatbot Grok
Es ist kein Geheimnis mehr, dass Künstliche Intelligenz sogenannte „Halluzinationen“ produziert, also Tatsachen frei erfindet, die faktisch unzutreffend sind. Doch nun ziehen solche Halluzinationen auch konkrete rechtliche Konsequenzen nach sich: Das Landgericht Hamburg (Beschluss vom 23. 09. 2025 – 324 O 461/25) hat dem Verein Campact e. V. im Eilverfahren Recht gegeben und eine einstweilige Verfügung gegen den Betreiber der Plattform X und die damit verbundene KI-Lösung Grok erlassen.
Der Betreiber hinter Grok ist das KI-Unternehmen xAI LLC von Elon Musk. Grok ist ein KI-Chatbot das auf X direkt Antworten generiert. Ausgangspunkt des Beschlusses war eine Diskussion auf X über einen Artikel des Ärztenachrichtendienstes, in dem eine Forderung der Grünen nach stärkerer Kontrolle finanziell motivierter Terminvergaben thematisiert wurde. In den Kommentaren entbrannte eine Debatte über die angebliche „links-grüne Agenda“ von NGOs. Dabei schaltete sich Grok ein und mahnte mehrfach sein Leitprinzip „Fakten statt Verschwörung“ an. Auf Nachfrage nach Beispielen nannte Grok schließlich mehrere Organisationen, die angeblich staatlich finanziert würden – darunter BUND, NABU, Agora Energiewende und auch Campact. Grok behauptete, Campact erhalte „einen hohen Anteil aus Bundesmitteln“, obwohl dies nicht zutrifft. Das Gericht sah hierin eine unwahre Tatsachenbehauptung und verpflichtete xAI, deren weitere Verbreitung zu unterbinden.
Das LG Hamburg stellte klar: Für KI-erstellte Aussagen eines öffentlichen Accounts wie Grok haftet dessen Betreiber – in diesem Fall xAI. Dass die Aussage von einer KI stammt oder ein allgemeiner Hinweis auf mögliche Fehler vorangestellt war, spielt rechtlich keine Rolle. Grok selbst betont, faktenbasiert zu arbeiten – für Nutzer entsteht damit der Eindruck verlässlicher Informationen. Ein abschließendes Urteil im Hauptsacheverfahren steht aus – erst dann könnte ein Präzedenz setzen der Fall entstehen.
Campact zeigte sich zufrieden: „Der Beschluss ist ein wichtiges Signal im Kampf gegen Fake News“, erklärte Geschäftsführerin Astrid Deilmann. Auch KI-Systeme müssen „der Wahrheit verpflichtet“ sein – und dürften falsche Behauptungen nicht einfach hinnehmen.
Legal Education 2.0
Wie sich die Jurist:innenausbildung im digitalen Zeitalter neu erfinden muss
KI-Vertragsgeneratoren, automatisierte Gutachten und Software, die schneller arbeitet als viele Berufseinsteiger:innen, sind Realität. Der juristische Beruf wandelt sich rasant – doch die Ausbildung bleibt stehen.
Doch wenn sich der juristische Beruf verändert – warum bleibt die Ausbildung gleich?
Ein Blick darauf, wie die Ausbildung von morgen aussehen muss, um angehende Jurist:innen auf den Arbeitsalltag vorzubereiten.
Vermittlung von Kompetenzen statt Wissen
Die juristische Lehre, sei es an der Uni oder beim Repetitorium, ist noch immer auf Auswendiglernen ausgelegt – obwohl alles Wissen längst digital abrufbar ist: auf Beck-Online, juris oder über KI-Tools wie ChatGPT.
Juristische Kompetenz heißt nicht, alles zu wissen, sondern argumentativ und strukturiert zu denken. Dafür braucht es neue Lehrformate: weniger Frontalunterricht, mehr digitales Selbststudium und Universitäten als Orte für Austausch, Diskussion und gemeinsames Lernen.
Tool-Kompetenz statt Tool-Verbot
Jurist:innen müssen lernen, digitale Werkzeuge souverän zu nutzen, egal ob Beck-Online oder die neuesten KI-Tools. Doch aktuell werden diese kaum geschult, in Prüfungen sind sie meist verboten. Damit bildet das Studium Studierende nicht für den Beruf aus, den sie ausüben werden, sondern für eine Vergangenheit, die es nicht mehr gibt.
Die Prüfungen müssen an die Zukunft des Berufs angepasst werden und den Arbeitsalltag realistischer widerspiegeln. Der Einsatz von digitalen Tools in Klausuren sollte erlaubt werden, um auch die digitale Kompetenz, die später von Jurist:innen erwartet wird, abzuprüfen. Dies setzt natürlich voraus, dass entsprechende Kompetenzen zuvor bereits vermittelt worden sind.
Mehr interdisziplinärer Austausch
Jurist:innen arbeiten heute schon interdisziplinär. Anwält:innen zum Beispiel müssen nachvollziehen, wie wirtschaftliche Interessen entstehen. Und künftig werden sie auch verstehen müssen, wie KI-Systeme „denken“. Die Fähigkeit, sich in andere Fachbereiche einzuarbeiten, wird zur Kernkompetenz.
Deshalb sollte die Ausbildung schon früh daran anknüpfen: Grundlagen aus Wirtschaft und Informatik integrieren, interdisziplinäre Projekte fördern, Kooperationen mit anderen Fakultäten und Praxissemester in Unternehmen ermöglichen.
Fazit
Ziel der Jurist:innenausbildung muss sein, auf die späteren Berufe vorzubereiten. Da sich das Berufsbild von Jurist:innen momentan rasant wandelt, muss auch die Ausbildung revolutioniert werden. Wie schnell das passiert, darf mit Blick darauf, dass sich in den letzten Jahrzehnten trotz großem Reformbedarfs kaum etwas Grundlegendes geändert hat, bezweifelt werden.
Podcast-Tipp: Die Zukunft der juristischen Lehre
KI in der Klausurbewertung
In der aktuellen Episode unseres Podcasts wagen unsere Mitglieder Johannes Gohr und Thorsten Hoffmann gemeinsam mit Alexandra Elena Müller und Simon Alexander Nonn von DeepWrite den Blick in die Zukunft der juristischen Ausbildung. Im Zentrum der Diskussion steht eine spannende Frage: Kann künstliche Intelligenz die juristische Klausurbewertung revolutionieren?
Besonders im Fokus: die Subsumtion als das Herzstück juristischen Arbeitens. Hier erläutert DeepWrite, wie ihre KI es schafft, rechtlich komplexe Gedankengänge nachzuvollziehen – und wo die Herausforderungen, wie etwa das Vermeiden sogenannter „Halluzinationen“, liegen. Die Gäste geben Einblicke in den verantwortungsvollen Umgang mit KI-gestützten Lösungen und zeigen auf, wie Studierende individuell und unmittelbar von automatisierten Feedbackprozessen profitieren können.
Ein spannendes Gespräch, das zum Nachdenken über Chancen, Risiken und die Zukunft der juristischen Lehre anregt. Hört jetzt gerne rein um einen Einblick in die juristische Lehre der Zukunft zu gewinnen!
Jetzt anhören!
Veranstaltungstipp
Legal AI Challenge Compact – Libra x recode.law
Ein neues Format für Jurist:innen trifft auf KI! Gemeinsam mit Libra starten wir den Promptathon: Legal AI Challenge Compact.
Am 27. November 2025 ab 18 Uhr erwartet euch auf dem Merantix Campus in Berlin ein kompaktes Event voller Kreativität, Praxisnähe und einem Hauch Wettbewerb.
In nur zwei Stunden erlebt ihr, wie sich juristische Denkarbeit und KI zu spannenden Lösungen verbinden lassen. Vor Ort werdet ihr in Teams eingeteilt und arbeitet mit Libra an einer echten juristischen Challenge rund um das Herzstück einer zivilrechtlichen Urteilsklausur.
Das Format richtet sich an fortgeschrittene Jurist:innen, etwa Referendar:innen oder ambitionierte Nachwuchsjurist:innen, die KI nicht nur verstehen, sondern hands-on erleben wollen.
Veranstaltungstipp
German Legal Tech Summit
Gerne möchten wir euch auf den German Legal Tech Summit am 4. Dezember 2025 im Convention Center Hannover aufmerksam machen. Es ist das größte Kongressfestival für Legal Tech, digitale Transformation und juristische Innovation in Deutschland und steht in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft der Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig.
Der Summit bringt rund 800 Teilnehmer*innen aus Kanzleien, Rechtsabteilungen, Start-ups, Tech-Unternehmen, öffentlicher Verwaltung, Justiz und Wissenschaft zusammen – mit dem Ziel, zentrale Innovationsfragen im Rechtsbereich zu diskutieren und aktiv zu gestalten. Im Mittelpunkt steht der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf den Rechtsmarkt. Unter dem Motto „Next Level Law – Zukunft gestalten“ geht es dabei um aktuelle Entwicklungen wie automatisierte Vertragsanalyse, KI-gestützte juristische Recherche, Dateninfrastrukturen für Legal AI, regulatorische Rahmenbedingungen und neue juristische Berufsbilder.
Das Programm bietet eine Mischung aus hochkarätigen Keynotes, praxisnahen Panels, Solution Hubs, Master Classes und Workshops. Neben führenden Stimmen aus Recht, Technologie und Wissenschaft gestaltet auch das neue Young Professional Board das Programm mit. Ein Highlight ist die Start-up Pitch Trophy, bei der acht ausgewählte Legal Tech-Start-ups gegeneinander antreten.