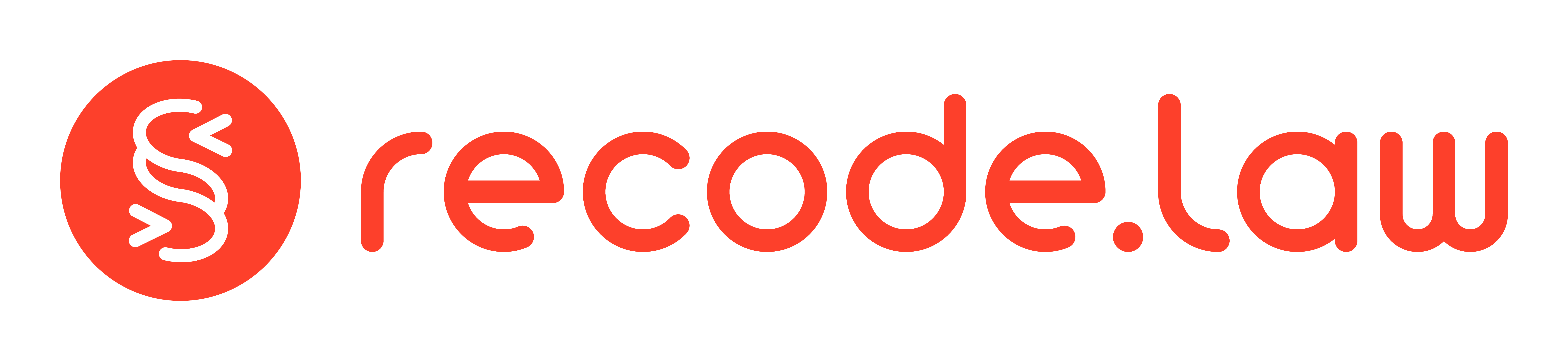Angesichts der Bundestagswahl am kommenden Sonntag haben wir uns die Wahlprogramme der Parteien angeschaut und in diesem Artikel die Pläne der Parteien hinsichtlich der Digitalisierung zusammengefasst.
Vorab wichtig zu wissen: Im Vergleich zu unseren Artikeln zu den Wahlprogrammen vor 3,5 Jahren (Digitalministerium: https://recode.law/bekommen-wir-ab-sonntag-das-digitalministerium/, Wirtschaft: https://recode.law/digitalisierung-und-wirtschaft-gruenden/, E-Government: https://recode.law/virtualgovernment/, Justiz: https://recode.law/3058-2/) und dem Koalitionsvertrag der vergangenen Legislaturperiode (https://recode.law/ampeldigitalisierung/) zeigt sich, dass die Digitalisierung zwar auf der Agenda stand, und trotzdem nicht ausreichend umgesetzt wurde. So wurden laut Koalitionstracker gerade einmal 6 % der Digitalisierungsprojekte umgesetzt und weitere 6 % zumindest teilweise umgesetzt (https://fragdenstaat.de/koalitionstracker/ampelkoalition-2021/vorhaben/verwaltungsdigitalisierung/, https://fragdenstaat.de/koalitionstracker/ampelkoalition-2021/digitales/). Zudem liegt Deutschland auch nach dem eGovernment Benchmark 2024, einem Bericht der EU, der die Digitalisierung der Verwaltungen in der EU analysiert (https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/node/12898) nur im Mittelfeld und hat erhebliches Steigerungspotenzial (eGovernment Benchmark 2024 Insight Report, S. 6).
Und auch in der Realität können wir das erkennen: Bisher haben wir weder ein Ministerium für Digitales noch eine App, mit der wir alle Behördengänge online vornehmen können.
Für uns heißt dies: Wieder Zeit für Wahlversprechen der Parteien! Denn was vor 3,5 Jahren schon versprochen wurde, wird von den Parteien erneut vorgeschlagen. Es bleibt abzuwarten, ob neben den (medialen) Schwerpunktthemen des aktuellen Wahlkampfs – Migration und Wirtschaft – die Digitalisierung im nächsten Koalitionsvertrag eine Rolle spielen wird. Im Vergleich zur letzten Wahl sind sich die Parteien diesmal sehr einig – worauf warten sie dann noch?
Digitalministerium, digitale Verwaltung, digitaler Zugang
Die CDU/CSU präsentieren sich als großer Befürworter eines Digitalministeriums: Bereits am Anfang des Wahlprogramms stellen sie klar: “Wir treiben mit Digitalisierung sowie souveränen KI- und Cloudanwendungen die Re-Industrialisierung unseres Landes voran. Zukunftstechnologien brauchen Freiräume, der Staat braucht klare Zuständigkeiten. Dazu richten wir ein Bundesdigitalministerium ein.” (https://www.politikwechsel.cdu.de/sites/www.politikwechsel.cdu.de/files/downloads/km_btw_2025_wahlprogramm_langfassung_ansicht.pdf, S. 2). Doch mit welchen Kompetenzen soll dieses ausgestattet sein? CDU/CSU schlagen vor, dass dort die gesamte Beschaffung von IT im Bund und die einheitlichen Schnittstellen für IT-Systeme im öffentlichen Bereich geregelt werden sollen (S. 28).
Neben dem Buzzword des Digitalministeriums planen die CDU/CSU ein digitales Bürgerkonto, bei dem die Bürgerinnen und Bürger eine digitale Akte erhalten, die alle relevanten Dokumente bündelt, und zudem eine europaweit gültigen digitalen Ausweisfunktion per Smartphone ermöglichen soll (S. 27). Gleichzeitig möchten die CDU/CSU mit Künstlicher Intelligenz “eine effiziente, vollständig digitalisierte Verwaltung für Bürger und Unternehmen auf[bauen], die rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche niederschwellig und nutzerfreundlich Serviceleistungen erbringen kann” (S. 27/28). Als Kurzfassung kann man die Pläne der CDU/CSU daher als Bundesdigitalministerium, digitale Verwaltung und vollständig digital zugängliche Verwaltung bezeichnen.
Zumindest letzteres sollte nach dem OZG-Gesetz bereits Ende 2022 erreicht worden sein (https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/verwaltungsmodernisierung/onlinezugangsgesetz/onlinezugangsgesetz-node.html). Die SPD stellt dies sogar in ihrem Wahlprogramm klar: “Wir wollen die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung beschleunigen. Die Digitalisierung der deutschen öffentlichen Verwaltung hat hohe Priorität. Seit 2023 gibt es eigentlich einen gesetzlichen Anspruch der Bürgerinnen und Bürger, dass sie jede Verwaltungsleistung digital beauftragen können. Wir brauchen mehr Tempo und Konsequenz bei der Realisierung dieses Anspruchs.” (https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD_Programm_bf.pdf, S. 38). Bei diesen Sätzen könnte man allerdings auch vermuten, dass die SPD in den letzten Jahren auf der Oppositionsbank statt im Kanzleramt saß.
Generell unterscheiden sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP bei ihren Digitalisierungsplänen kaum, auch nicht von der CDU. Sie alle fordern den Dreiklang der CDU/CSU: ein Digitalisierungsministerium, die weitergehende Digitalisierung der Verwaltung sowie eine digital zugängliche Verwaltung – konkret die eID (die digitale Ausweisfunktion und Signierfunktion) und die DeutschlandID (digitaler Zugang zur Verwaltung) ( (SPD: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD_Programm_bf.pdf, S. 38, Grüne: https://cms.gruene.de/uploads/assets/20250205_Regierungsprogramm_DIGITAL_DINA5.pdf , S. 32 – 36, FDP: https://www.fdp.de/sites/default/files/2024-12/fdp-wahlprogramm_2025.pdf, S. 37, 38)).
Wirkliche Unterschiede der bisherigen Regierungsparteien lassen sich nicht finden:
Die SPD nennt zwar anders als Grüne und FDP nicht das Wort “App”, sondern spricht nur von DeutschlandID, die “einen modernen Zugang zu staatlichen Leistungen” schafft, aber meint damit vermutlich in etwa das gleiche. Die Grünen versprechen eine “plattformunabhängige Deutschland-App auf Open-Source-Basis” und erklären, dass “darin […] schrittweise alle staatlichen Verwaltungsangebote und Leistungen sicher, unkompliziert, barrierefrei und anwendungsfreundlich zur Verfügung stehen” sollen und “man künftig mit wenigen Klicks zum Beispiel einen Personalausweis beantragen oder die neue Wohnung anmelden” können soll. Daneben versprechen sie im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung eine “eigene Cloud für die Verwaltung, die Sicherheit, Datenschutz, Quelloffenheit und Anbieterunabhängigkeit gewährleistet”. Die FDP möchte zudem “alle relevanten Register, wie z.B. Melderegister, Unternehmensregister und Gesundheitsregister, vollständig digitalisieren und vernetzen” und spricht anstatt von einer App von einem “digitalen Wallet [in dem sie] ihre wichtigsten Dokumente und Nachweise sicher und jederzeit griffbereit auf ihrem Smartphone speichern und miteinander verknüpfen können” sowie davon, dass sie so Behördengänge auch von zu Hause ermöglichen möchte. Zudem ist sie die einzige Partei, die explizit auch “einfach zu bedienende Terminals vor Ort in den Behörden und Unterstützung durch menschliche Digitallotsen” sowie einen “KI-Bürgerassistenten […],, der Bürgerinnen und Bürger bei digitalen Behördengängen unterstützt”, einführen möchte (https://www.fdp.de/sites/default/files/2024-12/fdp-wahlprogramm_2025.pdf, S. 37, 38).
Und die anderen…
Doch was fordern die anderen Oppositionsparteien? Zusammengefasst wird der “Dreiklang” (digitales Ministerium, digitale Verwaltung und digitale Behördengänge) von AfD, Linke und BSW nicht in dieser Weise gefordert: Stattdessen wird vor allem ein Augenmerk auf Open-Source gelegt:
Die in Teilen rechtsextreme AfD erklärt das “Vorantreiben der Digitalisierung der Verwaltung” zwar als Ziel (https://www.afd.de/wp-content/uploads/2025/02/AfD_Bundestagswahlprogramm2025_web.pdf, S. 14), trotzdem bleibt unklar, was das konkret heißt und wie sie dies erreichen möchte. Im weiteren Wahlprogramm fordert die AfD die “Erstellung einer Bundesstrategie für digitale Souveränität, um die Autonomie der Bürger im digitalen Zeitalter zu gewährleisten und staatliche Institutionen sowie kritische Infrastruktur effektiv zu schützen.”. Sie führt dazu aus, dass “Zu Elementen dieser Strategie […] zum Beispiel Open-Source-Techniken und dezentrale Systeme, wie auch die Entwicklung bundeseigener Hard- und Software für Kritische Infrastruktur [gehören].” (S. 50). Zusammengefasst fordert die AfD also eine Strategie und die Digitalisierung der Verwaltung. An dieser Stelle hätten wir uns gerne etwas konkretere Vorschläge gewünscht.
Die Linke fordert “viel mehr Open-Source-Software”, um “unabhängiger von digitalen Monopolen und ihren hohen Lizenzgebühren” zu werden. Zudem fordert sie, dass “der elektronische Personalausweis und die Gesundheitskarte müssen an eine physische Chipkarte gebunden bleiben” sollen (https://www.die-linke.de/fileadmin/user_upload/Wahlprogramm_Langfassung_Linke-BTW25_01.pdf, S. 58).
Die Open-Source-Software fordert das BSW auch und geht dabei noch weiter: “Software-Hersteller sollen bei Marktaustritt verpflichtet werden, ihre Produkte als Open Source zu publizieren oder Lizenzcodes für deren Nutzung offenzulegen.” (https://bsw-vg.de/wp-content/themes/bsw/assets/downloads/BSW%20Wahlprogramm%202025.pdf, S. 43). Daneben fordert das BSW ein “zentralen OnlinePortal für Bürger und Unternehmen als „One-Stop-Shop“ für alle behördlichen Dienstleistungen, in dem Daten nur einmal eingegeben werden müssen” (S. 18, 19). Daneben fordert das BSW auch einen “nationalen Tag der Entrümpelung […], der zweimal im Jahr stattfindet”. Konkret sollen “in Behörden […] Führungskräfte und Mitarbeiter an diesem Tag den Fokus darauf richten, welche Regeln und Richtlinien nicht mehr gebraucht werden und wie Verfahren und Prozesse vereinfacht und beschleunigt werden können (S. 18, 19).
Insgesamt zeigt sich, dass die CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP viele sehr ähnliche Pläne haben. Gerade die Parteien mit den derzeit besten Chancen auf eine Regierungsbeteiligung (CDU/CSU, SPD, Grüne) haben kaum Unterschiede, sodass wir eigentlich bereits in diesem Jahr ein Digitalministerium bekommen, spätestens in vier Jahren auch die Verwaltung digitaler, und die Behördengänge digital möglich sein sollten.
Ein Blick auf den Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung (https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf) führt allerdings zur Ernüchterung: Vorhaben wie die “Verwaltungsmodernisierung: Die Verwaltung soll agiler und digitaler werden.” (S. 7), ein “digitales Gesetzgebungsportal [zu] schaffen, über das einsehbar ist, in welcher Phase sich Vorhaben befinden” (S. 8), die “Weiterentwicklung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) […] mit der eine klare Standardisierung und Vereinheitlichung von IT-Verfahren nach dem Einer-für-alle-Prinzip (EfA) unterstützt wird” sowie “klare Verantwortlichkeiten” und das zentrale Zusammenführen der IT-Budgets des Bundes (S. 12) wurden teilweise zwar angegangen, trotzdem sieht man noch nicht ausreichende Fortschritte.
Was hat sich aber seit der letzten Wahl verändert? Inzwischen haben nicht nur die FDP und CDU/CSU das Digitalisierungsministerium im Wahlprogramm (https://recode.law/bekommen-wir-ab-sonntag-das-digitalministerium/), sondern auch SPD und Grüne. Die im Artikel vor 3,5 Jahren aufgeworfene Frage “Bekommen wir ab Sonntag das Digitalministerium” müssten wir daher eigentlich mit “Ja” beantworten dürfen – immerhin hat es dafür keine 4 Jahre gedauert.
Bezüglich der Verwaltung haben wir unseren Artikel damals folgendermaßen abgeschlossen: “Schön ist ja zu sehen, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien zum Thema Digitalisierung und Verwaltung viele gemeinsame Ideen teilen. Bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2025 könnte die Verwaltung also so aussehen:
- die Behörden sind digital gut ausgestattet und ausgebildet,
- alle Behördengänge können digital gemacht werden – egal welche alltäglichen Dinge es auch sind
- und die Behörden kommunizieren untereinander – der Bürger muss dies nur genehmigen, kann sich ansonsten aber zurücklehnen.”
Zwar sind nun deutlich mehr Behördengänge digital möglich, trotzdem bleibt dies eine Wunschvorstellung – hoffentlich spätestens für 2029. Denn: Statt die gleichen Forderungen wieder in 4 Jahren zu lesen, sollten diese umgesetzt werden!
Positiv hervorheben muss man allerdings, dass in der Digitalisierung der Justiz doch ein bisschen was passiert ist. Darunter fallen bspw. Justizprojekte der Länder zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Deshalb bleibt die Hoffnung, dass es in den nächsten 4 Jahren neben dem angesprochenen Dreiklang dann auch KI-Projekte in der Verwaltung gibt, die der Bund zusammen mit den Ländern umsetzt. Dann müssten die Parteien auch nichts Digitales mehr versprechen, sondern können auf ihren Erfolg bei Digitalisierungsprojekten verweisen.
Last Updated on 10. April 2025